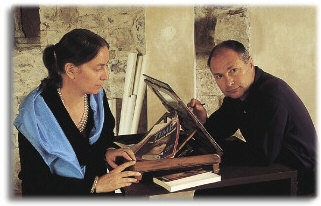 Die aus dem in der Oberstadt gelegenen Atelier von Donizetti stammenden und
unten in der Galleria Arsmedia, im künstlerischen Herzen von Bergamo, zwischen der
Carrara und der Galleria d’Arte Moderna, ausgestellten Zeichnungen zeugen von der
Schönheit der geheimen Dokumente, die der Maler zu Hunderten mit unvergleichlicher
Sorgfalt, vielleicht aufgrund der Papier und Bleistift innewohnenden Gebrechlichkeit
aufbewahrt, auch wenn es sich dabei um eine scheinbare Gebrechlichkeit handelt, die sehr
wohl dazu in der Lage ist, den vorübergehenden Jahrhunderten Stand zu halten.
Die aus dem in der Oberstadt gelegenen Atelier von Donizetti stammenden und
unten in der Galleria Arsmedia, im künstlerischen Herzen von Bergamo, zwischen der
Carrara und der Galleria d’Arte Moderna, ausgestellten Zeichnungen zeugen von der
Schönheit der geheimen Dokumente, die der Maler zu Hunderten mit unvergleichlicher
Sorgfalt, vielleicht aufgrund der Papier und Bleistift innewohnenden Gebrechlichkeit
aufbewahrt, auch wenn es sich dabei um eine scheinbare Gebrechlichkeit handelt, die sehr
wohl dazu in der Lage ist, den vorübergehenden Jahrhunderten Stand zu halten.
Es genügt, einen Blick auf diese Sammlung von Zeichnungen zu werfen, um unverzüglich die Kunst und die Philosophie Donizetti’s offensichtlich werden zu lassen. "Sie sind ein Ausdruck des Seins, des Geistes, sie sind ein Ausdruck des Lebens – hat Jean-Louis Ferrier geschrieben – In jeder Zeichnung ist eine weitere "Zeichnung" enthalten ...". Eine "Zeichnung", ein Ziel, eine Zweckmäßigkeit. Und diese Zweckmäßigkeit liegt bisweilen auch in dem Gemälde, von dem diese wiederholten Studien, das Zeichen für die Abwicklung einer Idee bilden.
 Um bei der Ausstellung zu bleiben, so betrachte man zum Beispiel
eine der ersten auf dem Katalogumschlag abgebildeten Zeichnungen (1950) der äußerst
dramatischen Kreuzigung (1951). Der Körper von Jesus ist beinahe in horizontaler Lage
dargestellt, so als ob er eben erst auf dem Kreuz niedergelegt worden wäre. Die Soldaten
haben ihn noch nicht am Kreuz festgenagelt, und auch noch nicht festgebunden, wie dies im
endgültigen Gemälde der Fall ist. Das rechte Bein ist stärker angewinkelt, das Kreuz in
der vollkommen gewagten und ungewöhnlichen Perspektive des Bildes, in seiner äußerst
menschlichen Dramatik, noch nicht aufgerichtet. Der Blick von Jesus’ Augen ist noch
auf uns gerichtet. Im Gemälde hingegen sind sie in der Todesfinsternis, vielmehr noch in
der beklemmenden Finsternis des Abstiegs in die Unterwelt, die durch die – äußerst
gewagte – perspektivische Verkürzung auf dem dunkelblauen Untergrund noch
hervorgehoben wird, geschlossen. Jener Christus ist die Personifikation der leidenden
Menschheit, stellt den an das Kreuz der Ungerechtigkeiten und der äußersten Armut
festgenagelten und festgebundenen Menschen dar, spiegelt den allein gelassenen Menschen
wieder, der nicht einmal die Barmherzigkeit einer Mutter, eines Bruders, einer
"gottesfürchtigen Frau" kennt. Es scheint sich um einen Christus zu handeln,
dem die Auferstehung versagt ist. Aber "am dritten Tag...".
Um bei der Ausstellung zu bleiben, so betrachte man zum Beispiel
eine der ersten auf dem Katalogumschlag abgebildeten Zeichnungen (1950) der äußerst
dramatischen Kreuzigung (1951). Der Körper von Jesus ist beinahe in horizontaler Lage
dargestellt, so als ob er eben erst auf dem Kreuz niedergelegt worden wäre. Die Soldaten
haben ihn noch nicht am Kreuz festgenagelt, und auch noch nicht festgebunden, wie dies im
endgültigen Gemälde der Fall ist. Das rechte Bein ist stärker angewinkelt, das Kreuz in
der vollkommen gewagten und ungewöhnlichen Perspektive des Bildes, in seiner äußerst
menschlichen Dramatik, noch nicht aufgerichtet. Der Blick von Jesus’ Augen ist noch
auf uns gerichtet. Im Gemälde hingegen sind sie in der Todesfinsternis, vielmehr noch in
der beklemmenden Finsternis des Abstiegs in die Unterwelt, die durch die – äußerst
gewagte – perspektivische Verkürzung auf dem dunkelblauen Untergrund noch
hervorgehoben wird, geschlossen. Jener Christus ist die Personifikation der leidenden
Menschheit, stellt den an das Kreuz der Ungerechtigkeiten und der äußersten Armut
festgenagelten und festgebundenen Menschen dar, spiegelt den allein gelassenen Menschen
wieder, der nicht einmal die Barmherzigkeit einer Mutter, eines Bruders, einer
"gottesfürchtigen Frau" kennt. Es scheint sich um einen Christus zu handeln,
dem die Auferstehung versagt ist. Aber "am dritten Tag...".
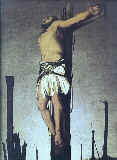 Auch für den gekreuzigten Menschen wird "der dritte Tag"
kommen. Im Grunde handelt es sich dabei um das große Versprechen der Seligpreisungen.
Auch für den gekreuzigten Menschen wird "der dritte Tag"
kommen. Im Grunde handelt es sich dabei um das große Versprechen der Seligpreisungen.
Schrecklich und trostlos stellt sich die Einsamkeit auch in dem zweiten
ausgestellten Gekreuzigten, der im Jahr 1959 entstanden ist, dar. Die Farbgebung, und mit
ihr der Untergrund, sind heller geworden.
Aber in dem hellen und fahlen Licht gleichen die Bäume nur noch sterilen, schwarzen
Pfählen, den Richtstätten für neue Kreuzigungen.
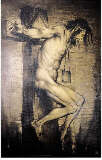 Neben diesen beiden Gemälden von Kreuzigungen ist auch der
Gekreuzigte (1969) aus dem vatikanischen Museo del Tesoro ausgestellt. Und niemals gab es
einen dramatischeren Gekreuzigten, niemals hat er eine noch größere Erniedrigung
erfahren, nie war er so entblößt und verspottet, nie war er so wehrlos und gleichzeitig
so großartig und heldenhaft dargestellt worden. Eiserne, trübe und der Dämmerung
entstammende Farbgebungen stehen im Todeskampf mit der Christusfigur. Die Inschrift mit
dem Grund der Verurteilung ist nicht am Kreuz oben zu lesen, sondern sie hängt
schmachvoll an Jesus’ Hals. Sein Körper befindet sich mit stark angewinkelten Beinen
sitzend auf einem Brett, das dunkel und unermeßlich aus dem Kreuz selbst herausragt. Der
letzte Blick im Todeskampf gilt der blinden Grausamkeit des Menschen als Masse, des
Menschen als Individuum, des Menschen als Machthaber. "Vater, vergib ihnen, denn sie
wissen nicht, was sie tun ".
Neben diesen beiden Gemälden von Kreuzigungen ist auch der
Gekreuzigte (1969) aus dem vatikanischen Museo del Tesoro ausgestellt. Und niemals gab es
einen dramatischeren Gekreuzigten, niemals hat er eine noch größere Erniedrigung
erfahren, nie war er so entblößt und verspottet, nie war er so wehrlos und gleichzeitig
so großartig und heldenhaft dargestellt worden. Eiserne, trübe und der Dämmerung
entstammende Farbgebungen stehen im Todeskampf mit der Christusfigur. Die Inschrift mit
dem Grund der Verurteilung ist nicht am Kreuz oben zu lesen, sondern sie hängt
schmachvoll an Jesus’ Hals. Sein Körper befindet sich mit stark angewinkelten Beinen
sitzend auf einem Brett, das dunkel und unermeßlich aus dem Kreuz selbst herausragt. Der
letzte Blick im Todeskampf gilt der blinden Grausamkeit des Menschen als Masse, des
Menschen als Individuum, des Menschen als Machthaber. "Vater, vergib ihnen, denn sie
wissen nicht, was sie tun ".
Wir sind Zeugen eines schrecklichen und würdevollen Ereignisses, dem unsere Ergriffenheit zuteil wird, und das uns in einen Zustand des Leidens versetzt.
Silvana Milesi